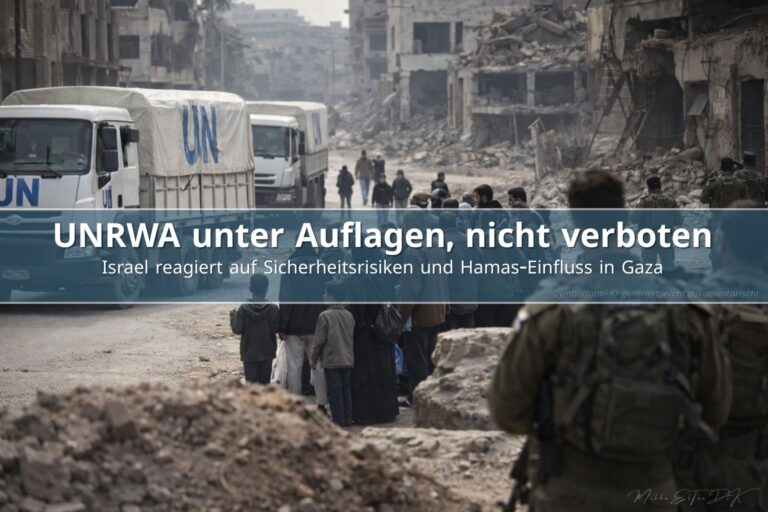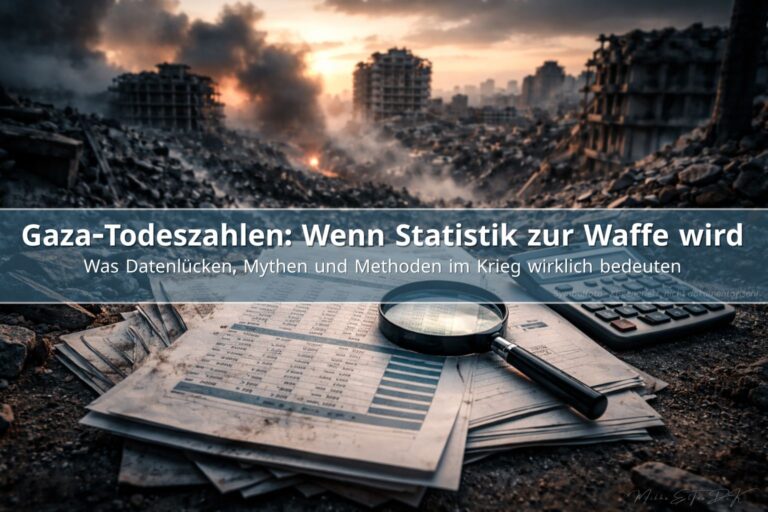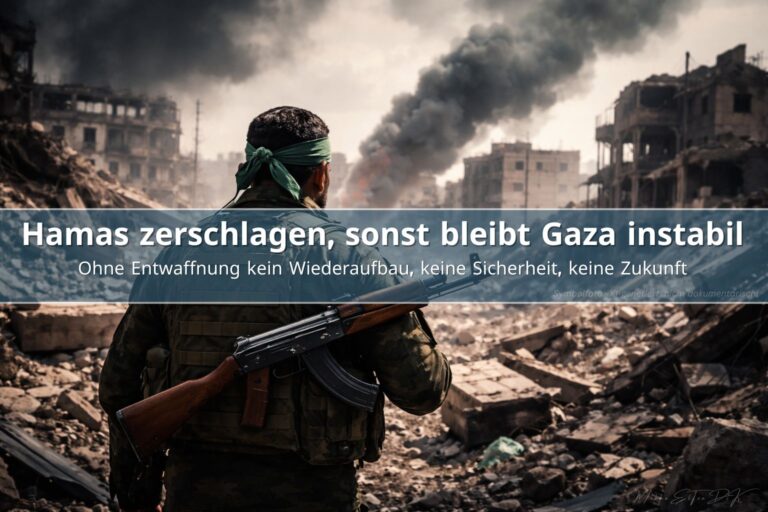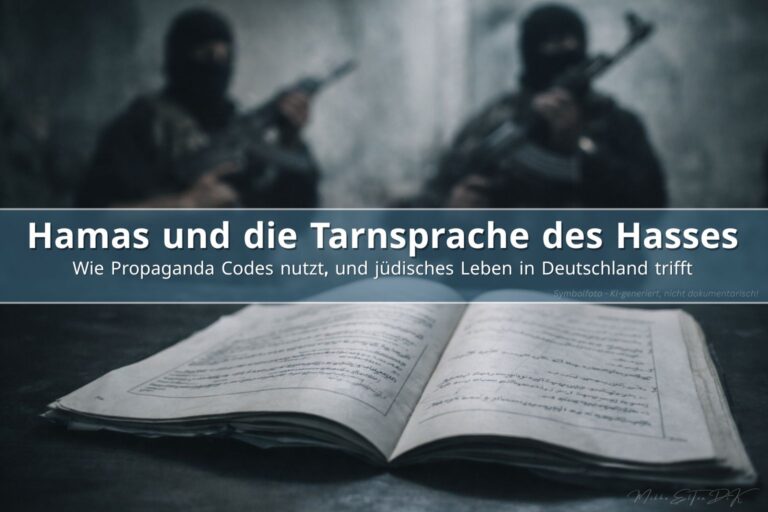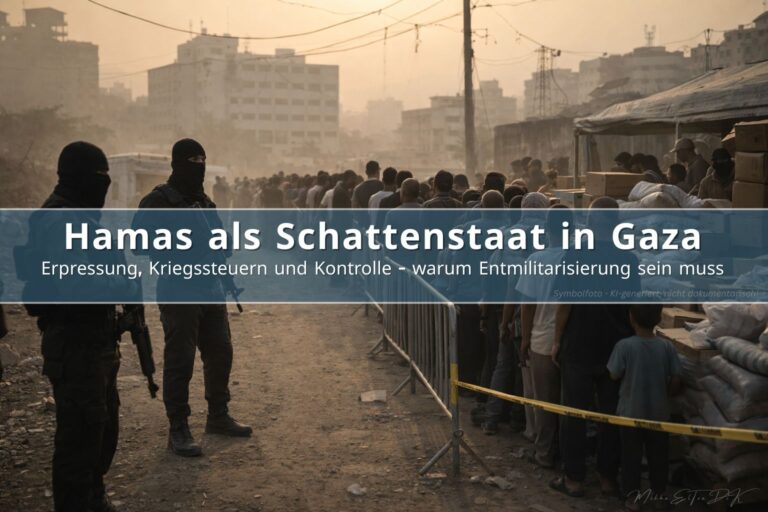Deutschland liefert wieder Waffen an Israel – und genau darum geht es in diesem Meinungsartikel. Berlin kehrt nach einem politisch motivierten Exportstopp zur eigenen Staatsräson zurück: der Sicherheit Israels. Warum dieser Kurswechsel nötig, richtig und überfällig ist, erkläre ich im Folgenden.
🔵 𝐌𝐞𝐢𝐧𝐮𝐧𝐠𝐬𝐚𝐫𝐭𝐢𝐤𝐞𝐥
𝐃𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐢𝐞𝐟𝐞𝐫𝐭 𝐰𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫 𝐖𝐚𝐟𝐟𝐞𝐧 𝐚𝐧 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥 – 𝐮𝐧𝐝 𝐝𝐚𝐬 𝐢𝐬𝐭 𝐠𝐮𝐭 𝐬𝐨
Ab dem 𝟐𝟒. 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟓 fließen wieder deutsche Rüstungsgüter nach Israel – Ersatzteile, Schutzsysteme, Motoren für Merkava-Panzer. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man ernst nimmt, was seit Angela Merkels historischer Rede 2008 als große Staatsformel durch jede Regierungserklärung wandert: 𝐃𝐢𝐞 𝐒𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫𝐡𝐞𝐢𝐭 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥𝐬 𝐢𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐚𝐭𝐬𝐫ä𝐬𝐨𝐧.
Dass die 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐫𝐞𝐠𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠 nun ihre eigene 𝐅𝐞𝐡𝐥𝐞𝐧𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞𝐢𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐨𝐫𝐫𝐢𝐠𝐢𝐞𝐫𝐭, ist richtig. Ehrlich wäre es, offen auszusprechen: 𝐃𝐢𝐞𝐬𝐞𝐫 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩 𝐯𝐨𝐦 𝟖. 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐡ä𝐭𝐭𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐦𝐚𝐥𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐡ä𝐧𝐠𝐭 𝐰𝐞𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐝ü𝐫𝐟𝐞𝐧.
Friedrich Merz hatte an jenem Tag die Reißleine gezogen und angeordnet, keine Rüstungsgüter mehr zu genehmigen, die potenziell im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. 𝐄𝐢𝐧𝐞 𝐄𝐧𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞𝐢𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞𝐦 𝐢𝐧𝐧𝐞𝐧𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦 𝐃𝐫𝐮𝐜𝐤 – 𝐯𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐦 𝐚𝐮𝐬 𝐓𝐞𝐢𝐥𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐏𝐃 𝐮𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐫 𝐙𝐢𝐯𝐢𝐥𝐠𝐞𝐬𝐞𝐥𝐥𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟𝐭 -, 𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐦𝐢𝐭 𝐝𝐞𝐫 𝐂𝐒𝐔 𝐚𝐛𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐦𝐭, 𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐝𝐮𝐫𝐜𝐡𝐝𝐚𝐜𝐡𝐭. Und vor allem: ein fatales Signal an den einzigen jüdischen Staat, der sich seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 in einem existentiellen Mehrfrontenkrieg gegen Hamas, Hisbollah, Huthi und den Iran befindet.
Der Internationale Gerichtshof in 𝐃𝐞𝐧 𝐇𝐚𝐚𝐠 hatte Deutschland 𝐳𝐮 𝐤𝐞𝐢𝐧𝐞𝐦 𝐙𝐞𝐢𝐭𝐩𝐮𝐧𝐤𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐩𝐟𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐭, Israel 𝐝𝐞𝐧 𝐇𝐚𝐡𝐧 𝐳𝐮𝐳𝐮𝐝𝐫𝐞𝐡𝐞𝐧. Der Eilantrag Nicaraguas wurde im April 2024 ausdrücklich abgewiesen – es gab keine juristische Auflage, keine völkerrechtliche Notwendigkeit. Der Stopp war 𝐫𝐞𝐢𝐧 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭 und 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐯𝐞𝐫𝐡𝐞𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝. Während Israels Feinde weiter mit iranischen Raketen und Drohnen angriffen, stellte sich Berlin selbst in die Pose des überlegenen Mahners – und ließ den bedrohten Verbündeten im entscheidenden Moment im Regen stehen.
𝐉𝐞𝐭𝐳𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐰𝐞𝐢𝐬𝐭 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠𝐬𝐬𝐩𝐫𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐞𝐥𝐢𝐮𝐬 𝐚𝐮𝐟 𝐝𝐢𝐞 𝐬𝐞𝐢𝐭 𝐝𝐞𝐦 𝟏𝟎. 𝐎𝐤𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐰𝐞𝐢𝐭𝐠𝐞𝐡𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐖𝐚𝐟𝐟𝐞𝐧𝐫𝐮𝐡𝐞, 𝐚𝐮𝐟 𝐝𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐬𝐜𝐡𝐫𝐢𝐭𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐝 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐭ä𝐫𝐤𝐭𝐞 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭ä𝐫𝐞 𝐇𝐢𝐥𝐟𝐞. 𝐃𝐚𝐬 𝐤𝐥𝐢𝐧𝐠𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐧ü𝐧𝐟𝐭𝐢𝐠, ä𝐧𝐝𝐞𝐫𝐭 𝐚𝐛𝐞𝐫 𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭𝐬 𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐊𝐞𝐫𝐧𝐰𝐚𝐡𝐫𝐡𝐞𝐢𝐭: 𝐃𝐢𝐞 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐫𝐞𝐠𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐬𝐬𝐭𝐞 𝐠𝐚𝐫 𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭𝐬 „𝐚𝐮𝐟𝐡𝐞𝐛𝐞𝐧“. 𝐒𝐢𝐞 𝐡𝐚𝐭 𝐥𝐞𝐝𝐢𝐠𝐥𝐢𝐜𝐡 𝐞𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐰𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐅𝐞𝐡𝐥𝐞𝐫 𝐳𝐮𝐫ü𝐜𝐤𝐠𝐞𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧, 𝐝𝐞𝐧 𝐬𝐢𝐞 𝐧𝐢𝐞 𝐡ä𝐭𝐭𝐞 𝐛𝐞𝐠𝐞𝐡𝐞𝐧 𝐝ü𝐫𝐟𝐞𝐧.
𝐃𝐞𝐧𝐧 𝐝𝐢𝐞 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭ä𝐭 𝐥ä𝐬𝐬𝐭 𝐬𝐢𝐜𝐡 𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐰𝐞𝐠𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧: Israel braucht diese deutschen Komponenten nicht aus Lust oder Laune, sondern um seine Soldaten und Zivilisten zu schützen. Wer diese Lieferungen blockiert, schwächt bewusst die Verteidigungsfähigkeit der einzigen Demokratie im Nahen Osten, die seit ihrer Gründung 1948 unter permanentem existentiellem Beschuss steht.
𝐌𝐞𝐫𝐳 𝐡𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐢𝐦 𝐖𝐚𝐡𝐥𝐤𝐚𝐦𝐩𝐟 𝐡𝐨𝐜𝐡 𝐮𝐧𝐝 𝐡𝐞𝐢𝐥𝐢𝐠 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐩𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞𝐧, 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥 𝐧𝐢𝐞𝐦𝐚𝐥𝐬 𝐢𝐦 𝐒𝐭𝐢𝐜𝐡 𝐳𝐮 𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧. Genau das ist mit seinem Solo-Exportstopp jedoch passiert. Teile der Union waren entsetzt, die israelische Regierung tief irritiert, jüdische Organisationen in Deutschland fassungslos. 𝐔𝐧𝐝 𝐝𝐢𝐞 𝐅𝐚𝐥𝐬𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐣𝐮𝐛𝐞𝐥𝐭𝐞𝐧: 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐢𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧, 𝐁𝐃𝐒-𝐧𝐚𝐡𝐞 𝐊𝐫𝐞𝐢𝐬𝐞 𝐮𝐧𝐝 𝐛𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐦𝐭𝐞 𝐍𝐆𝐎𝐬 feierten den deutschen Schritt als Beweis, dass Druck auf den jüdischen Staat „wirkt“. – 𝐆𝐞𝐧𝐚𝐮 𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐫𝐟 𝐧𝐢𝐞 𝐰𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫 𝐯𝐨𝐫𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧.
Selbstverständlich werden auch künftig 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 einzeln und 𝐬𝐨𝐫𝐠𝐟ä𝐥𝐭𝐢𝐠 𝐠𝐞𝐩𝐫ü𝐟𝐭 – so verlangt es das Gesetz, und so muss es sein. Aber eines ist entscheidend: 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐫𝐟 𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐭 𝐰𝐞𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐡𝐭𝐞 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐤𝐫𝐚𝐭𝐢𝐞𝐧. Deutschland liefert der Ukraine seit 2022 Panzer, Haubitzen, Luftabwehrsysteme in Milliardenhöhe – trotz eines brutalen Angriffskriegs mit Zehntausenden Toten. 𝐖𝐞𝐫 𝐠𝐥𝐞𝐢𝐜𝐡𝐳𝐞𝐢𝐭𝐢𝐠 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥 𝐚𝐮𝐬𝐛𝐫𝐞𝐦𝐬𝐭 𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐭 𝐒𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐫𝐞𝐠𝐞𝐥𝐧 𝐛𝐞𝐥𝐞𝐠𝐭, 𝐛𝐞𝐭𝐫𝐞𝐢𝐛𝐭 𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐃𝐨𝐩𝐩𝐞𝐥𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥, 𝐝𝐢𝐞 𝐰𝐞𝐝𝐞𝐫 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐜𝐡 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐳𝐮 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐢𝐬𝐭.
𝐃𝐞𝐫 𝟐𝟒. 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐢𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐬𝐡𝐚𝐥𝐛 𝐦𝐞𝐡𝐫 𝐚𝐥𝐬 𝐞𝐢𝐧 𝐛ü𝐫𝐨𝐤𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐃𝐚𝐭𝐮𝐦. 𝐄𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐢𝐞𝐫𝐭 𝐝𝐞𝐧 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐦 𝐃𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡𝐥𝐚𝐧𝐝 – 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐩ä𝐭𝐞𝐭, 𝐚𝐛𝐞𝐫 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐫𝐡𝐢𝐧 – 𝐳𝐮𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐧𝐮𝐧𝐟𝐭 𝐮𝐧𝐝 𝐳𝐮 𝐬𝐞𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐞𝐢𝐠𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐚𝐭𝐬𝐫ä𝐬𝐨𝐧 𝐳𝐮𝐫ü𝐜𝐤𝐤𝐞𝐡𝐫𝐭.
Wenn „𝐃𝐢𝐞 𝐒𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫𝐡𝐞𝐢𝐭 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥𝐬 𝐢𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐚𝐭𝐬𝐫ä𝐬𝐨𝐧“ mehr sein soll als eine Sonntagsrede, dann muss eines glasklar bleiben: 𝐍𝐢𝐞 𝐰𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐫𝐟 𝐝𝐢𝐞𝐬𝐞 𝐒𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫𝐡𝐞𝐢𝐭 𝐚𝐮𝐬 𝐢𝐧𝐧𝐞𝐧𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐍𝐞𝐫𝐯𝐨𝐬𝐢𝐭ä𝐭, 𝐚𝐮𝐬 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭 𝐯𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐧 𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞𝐦 𝐃𝐫𝐮𝐜𝐤 𝐳𝐮𝐫 𝐯𝐞𝐫𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐛𝐚𝐫𝐞𝐧 𝐆𝐫öß𝐞 𝐠𝐞𝐦𝐚𝐜𝐡𝐭 𝐰𝐞𝐫𝐝𝐞𝐧.
Wer „𝐍𝐢𝐞 𝐰𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫“ sagt, muss es auch meinen. Nicht nur in Gedenkstunden – sondern im Ernstfall. Mit Rückgrat. Mit Konsequenz. Mit Waffenlieferungen, wenn sie gebraucht werden.